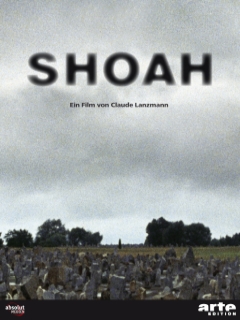Filmstill aus SHOA (Frankreich 1985) Regie: Claude Lanzmann. © absolut Medien GmbH. Mit freundlicher Genehmigung der absolut Medien GmbH.
Claude Lanzmanns Dokumentarfilm SHOAH behandelt 540 Minuten lang die Geschichte der Vernichtung der europäischen Juden in Interviews mit Überlebenden und porträtiert währenddessen die Orte und Wege dieses Geschehens in langen ruhigen Kamerafahrten. Lanzmann begann 1974 mit der Arbeit und brachte den Film 1985 zur Uraufführung. Anders als die meisten anderen Filme zum Thema verwendet Lanzmann für den Film kein Archivmaterial, richtet auch keine Kommentarebene ein – bzw. beschränkt sich hierin auf die für die neuere Filmgeschichte einigermaßen unübliche Praxis der Texttafeln, die wir eher aus den Anfängen des Kinos kennen.
Man weiß nun aus ähnlich umfänglichen und ambitionierten Projekten, dass bei einer solchen Arbeit weitaus mehr Material anfällt als schließlich in den fertigen Film eingegangen ist. Die heutige, im Zeichen der DVD übliche Director’s Cut – und Bonusmaterial-Praxis weist sogar unterdessen explizit darauf hin. Man weiß auch von und über Lanzmann, dass er den Film durch enorme Recherche- und Lektürearbeit vorbereiten musste, damit er schließlich die Überlebenden einer 40 Jahre zurückliegenden verdrängten, beschwiegenen oder vergessenen Vergangenheit kompetent und ausführlich über diese befragen konnte.
So fragt man sich schon angesichts der Menge des Materials und der Länge der Produktionszeit (und auch der Regisseur selbst fragt sich genau dies): Wie konnte der Film überhaupt zustande kommen? Technisch gesprochen: Wie ergab sich eine Notwendigkeit des späteren Films aus dem Material? Oder konkreter: Wie erfand man dem Film ein Ende, eine Mitte und einen Anfang – um in den Aristotelischen Kategorien zu sprechen? Wie konnte das Team oder der Regisseur überhaupt den nächsten Arbeitsschritt erkennen? Wie bekam der Film seine endgültige Gestalt – um das zentrale deutsche Wort Lanzmanns für diesen Punkt zu zitieren?
Antworten auf diese Fragen gab Claude Lanzmann vor kurzem selbst. In seinen 2009 zuerst in Paris erschienenen Erinnerungen „Der patagonische Hase“ widmet er sich erwartungsgemäß auf mehreren hundert Seiten seinem filmischen Hauptwerk. Man darf nun aber nicht die in den literarisch hochambitionierten Erinnerungen mitgelieferte Filmpoetik Lanzmanns mit abgeklärter Filmwissenschaft verwechseln. Dennoch steht im Mittelpunkt von Lanzmanns filmischer Poetik jener unübersetzte (und unübersetzbare) deutsche Begriff der Gestalt, der in dem (verwandten) filmischen Konzept der Szene all seine Implikationen zu entfalten vermag.
Claude Lanzmann behandelt und beschreibt in seinen (angeblich diktierten) Erinnerungen anlässlich von Gedanken zur Entstehung von SHOAH die zentrale Schwierigkeit der künstlerisch-kreativen und künstlerisch-dokumentarischen Tätigkeit: Es ist dies die Schwierigkeit, vom Sammeln und Vorbereiten des Materials zum Schreiben oder Drehen des Eigentlichen zu kommen. Es geht in jeder Poetik letztlich um den Sprung aus dem bloßen Material in das sogenannte Werk. Das Werk aber – sei es als begonnenes oder abgeschlossenes – etabliert sich als solches erst, wenn es sich von Gefundenem oder Versammeltem explizit abzuheben beginnt, wenn es jenen, den Künstler vom Handwerker abhebenden Anspruch der Eigenheit und des Kreativen erheben kann.
Dem Kunstwerk ist erst mit dieser Absetzbewegung, die einfach auch – das wissen wir schon seit Georg Simmel – ein Rahmen sein kann, etwas eingeschrieben, das mehr ist als seine Umgebung und deren Ordnung oder Unordnung. Das Kunstwerk entsteht also zuallererst in der Verweigerung gegenüber einer Frage, die Lanzmann wie folgt formuliert,
„der so zentralen, aber falschen Frage nach dem Warum mit all den endlosen, akademischen Frivolitäten und schäbigen Kunstgriffen, die sie mit sich bringt“ [1]
Auch Simone de Beauvoir, die einen der ersten ausführlichen Texte über SHOAH schrieb, hielt in ihrer Besprechung ausgerechnet am Kunstcharakter dieses Films fest und betonte, dass
„Claude Lanzmanns Gestaltung keiner chronologischen Ordnung unterworfen ist, ich würde eher sagen, daß wir es mit einer poetischen Konstruktion zu tun haben – wenn diese Bezeichnung bei einem solchen Thema angewendet werden darf. Es bedürfte einer ausführlichen Untersuchung, um auf die Resonanzen, Symmetrien, Asymmetrien und Harmonien hinzuweisen, auf denen diese Konstruktion beruht.“ [sic] [2]
Kunst behauptet und signalisiert, einfach mehr zu sein als bloßes Material. Woraus aber besteht dieses Mehr? Es besteht – neben eventuellen Rhythmisierungen, Assonanzen und Symmetrien – aus der Behauptung und Schilderung von Momenten, die es ermöglichen, der hoffnungslosen Zeitlichkeit und Verstreutheit des Materials entscheidend vorauszueilen. Damit aber sind wir funktionsgeschichtlich bei der Szene angelangt, denn Claude Lanzmann selbst inszeniert diesen Moment im Produktionsprozess von SHOAH rückblickend mit größtem schriftstellerischem Geschick im Namen der Szene. Zunächst geht es Lanzmann um das Zurückweisen des rein sammelnden Intellekts, der mit Gelehrsamkeit den Zugang zum Werk nur versperrt:
„Tatsächlich war ich vollgestopft mit dem Wissen, das ich mir in den vorangegangenen vier Jahren durch Lektüre, Nachforschungen und sogar beim Drehen angeeignet hatte.“ [3]
Anschließend dann muss der Moment gekennzeichnet werden, der dem Autor kurzzeitig eine Macht verleiht, die die umgebungshafte Gleichförmigkeit des Materials überwinden und neu ordnen hilft. Das genau geschieht bei Lanzmann angeblich mit dem ersten Anblick des Ortsschildes von Treblinka:
„Die Begegnung mit einem Namen und einem Ort fegte mein Wissen hinweg, zwang mich, wieder bei null anzufangen, auf radikal andere Art zu betrachten, was mich bis dahin beschäftigt hatte, alles umzuwerfen, was mir als absolut gewiss erschienen war. Treblinka wurde so wahr, dass es nicht länger warten konnte eine Dringlichkeit packte mich, die mich nicht mehr loslassen würde; ich musste drehen, so schnell wie möglich drehen das war der Auftrag, den ich an diesem Tag erhielt.“ [4]
Genau an dieser Stelle, an der Stelle, an der Lanzmann den ‚Schaffensprozess‘ als ‚höheren Auftrag‘ beim Namen nennt, versucht er ihn aber auch als eine Praxis zu erläutern – und kommt zu folgendem Ergebnis:
„Polen, davon bin ich überzeugt, wäre eine Art Dekor geblieben, und niemals hätte ich die Explosion erlebt, die mich am ersten Tag dort förmlich zerriss und mich auf einen Blick die Szenen erkennen ließ, die ich drehen, für deren Realisierung ich mit Hartnäckigkeit, Überzeugung und Erfindungsgeist auch die größten Schwierigkeiten überwinden musste.“ [5]
Dieses Bild und diese Philosophie des Schaffens beharrt darauf, dass das spätere mehrstündige filmische Kunstwerk in einem privilegierten und privilegierenden Moment schon als Ganzes aus wenigen Szenen erschienen war. Aber Stop! Filmszenen, das weiß heute jedes Kind, entstehen an Schneidetischen und Schnittcomputern – und nicht in explosiven Visionen. Die Szenen haben natürlich eine visuelle Dimension, aber eben nicht als mystisch-metaphysische Schauinsland-Technik.
Der sogenannte Schnitt findet auch noch Anfang der neunzehnhundertachtziger Jahre – ziemlich metaphysikfern und profan – an einem solchen Schneidetisch statt und ist eine Materialschnipselarbeit, die viel Zeit und Geduld erfordert. Ganz ähnlich wie die den Künstlerkopf mit Wissen vollstopfende Recherche und Lektüre ist der Schnitt eine Arbeit im und am überbordenden Material. Lanzmann meistert auch diese Hürde zunächst rhetorisch. Er verwandelt den Schnitt, die handwerkliche Produktion der Szenen und ihre Anordnung, ex post in ein genialisches, von den Notwendigkeiten und Gesetzen des Materials gerade abgehobenes Geschehen. Die geschnittenen Szenen verdanken, so schildert es uns Lanzmann, ihre Abfolge einem Moment der Einsamkeit:
„Es gibt keine Stimme, die ankündigt, was geschehen wird, die sagt, was man denken soll, die die einzelnen Szenen von außen miteinander verbindet. Solche für den klassischen Dokumentarfilm typischen Hilfsmittel sind in Shoah nicht erlaubt. Das ist ein Grund, weshalb sich der Film der Einordnung zwischen Dokumentarfilm und Fiktion entzieht. Der Schnitt war eine lange, schwierige, heikle Arbeit, die viel Feingefühl erforderte. Ich war oft völlig blockiert, wie bei einer Bergbesteigung, wenn man den Durchgang nicht findet, der einen weiter nach oben führt. Meist gibt es nur einen, einen einzigen richtigen.“ [6]
Die ‚Geburt des Films aus dem Erlebnis der Szene‘ könnte man formulieren, um die Szene als zentrale Untereinheit der schließlichen Gestalt des Films kenntlich zu machen. Doch hiermit endet es nicht. Als wäre nicht schon genügend belegt, dass die Szene eine Basisgröße aller Überlegungen Lanzmanns ist, beendet er seine Autobiographie mit einer Art Universalisierung genau dieser Kategorie, mit einer Art Rückgewinnung der Szene vom Film für das Leben: Die Szene wird wieder aus ihrem visuellen Grundcharakter herausschält, den ihr die Filmgeschichte verordnet hatte, und der Charakter einer anders gearteten sinnlichen Erfahrung wird ihr zurückgegeben.
„Auch wenn ich zu sehen vermag, ja mit einem seltenen visuellen Gedächtnis begabt bin, stehen Ausdrücke wie ‚das Schauspiel der Welt‘ oder ‚die Welt als Schauspiel‘ nach meinem Empfinden immer für eine uns arm machende Dissoziation, eine abstrakte Trennung, die Staunen und Begeisterung unmöglich macht, weil sie sowohl das Objekt wie das Subjekt um seine Wirklichkeit bringt. Als ich zwanzig war, ich habe es schon erzählt, ist Mailand erst wahr für mich geworden, als ich auf dem Weg über die Piazza del Duano für mich selbst die ersten Zeilen der Kartause von Parma laut zu rezitieren begann. Das ist ein Beispiel von vielen. Es gab die furchtbare Erschütterung in Treblinka mit ihren endlosen Konsequenzen, ausgelöst durch das Zusammentreffen eines Namens und eines Ortes, die Entdeckung eines fluchbeladenen Namens auf gewöhnlichen Ortsschildern, auf dem Bahnhofsschild, als sei dort nichts geschehen.“ [7]
Die Szene wird wieder ein akustisches Phänomen. Die Auswendigkeit eines Textes von Stendhal verleiht dem Erleben Mailands seine Konturen. Nicht mehr die visionäre momentane Berg-Schau über die Welt produziert das Kunstwerk als szenisches Arrangement, sondern die auswendige Rezitation einer kanonischen Buchpassage haucht den Kulissen Leben ein. Erst die akustische Ergänzung eines visuellen Eindrucks ergibt vor Ort auch die Realität und Wahrheit dieses Ortes als Szenerie. Im Falle Treblinkas, genauer: im Falle von SHOAH, ist es – ganz analog – der fluchbeladene, laut gefluchte Name, der die Szenen des Films blitzartig schneidet und in eine Ordnung bringt. Diese filmische Mytho-Poetik lässt die Arbeit am und mit dem Material vergessen, genauer: lässt die Idee noch einmal über das Material obsiegen.
Zur Person: Prof. Dr. Heiko Christians ist seit April 2008 Professor für Medienkulturgeschichte an der Universität Potsdam.
Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Medienpathologien (Kult/Amok/Sucht/Verschwörung) und Erzählungen (Imagination, Verteilung, Konsum). Seine Publikationen sind u. A. „Amok: Geschichte einer Ausbreitung“ (2008, Aisthesis Verlag). Der hier vorliegende Text ist eine verkürzte Version eines Kapitels aus seinem Buch „Die Szene. Zur Mediengeschichte des Verstehens“, das 2014 erscheinen wird.