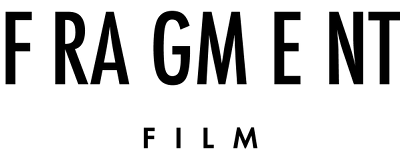Wer bei der Berlinale 2010 Gefallen am russischen Wettbewerbsfilm KAK YA PROVEL ETIM LETOM (englischer Festivaltitel: How I Ended This Summer) von Alexei Petrowitsch Popogrebski gefunden hat, wird auch den norwegischen Panoramabeitrag FJELLET von Ole Giæver mögen. Im Gegensatz zu Popogrebskis Film, bei dem das Zusammenspiel der beiden Hauptakteure eine zentrale Rolle einnimmt, sind in FJELLET sowohl die Personen als auch der Raum von besonderer Bedeutung.

Fjellet. Regie: Ole Giæver © Edition Salzgeber
Das Paar Solveig und Nora wandert durch die einsame norwegische Wildnis zu dem Berg, an dem ihr gemeinsamer kleiner Sohn Vetle bei einem früheren Familienausflug verunglückt ist. Nora, die die leibliche Mutter von Vetle ist, hat die Trauer über den Verlust des Sohnes nicht überwinden können und wurde mit der Zeit immer verbitterter. Solveig erhofft sich hingegen, dass durch diese Reise eine Veränderung bei Nora eintritt und die beiden Frauen sich wieder als Paar finden, gerade jetzt wo Solveig schwanger ist.
Erst im Verlauf des Films und mit der physischen Annäherung an den Berg, erfährt der Zuschauer, was zwischen den beiden passiert ist. Immer wieder stellen die beiden sich die Frage, wo sie mit ihrer Beziehung stehen und stellenweise hat es den Anschein, also ob ihre Beziehung aussichtslos ist und beide sich schon zu sehr voneinander entfernt haben.
Gerade in der im CinemaScope Format aufgenommenen unendlich weiten und einsamen norwegischen Natur, sticht die emotionale Distanz der beiden besonders hervor. Es ist gerade dieser immer wieder aufkommende Kontrast zwischen offensichtlicher körperlicher Nähe (sie wandern nebeneinander her und schlafen nachts gemeinsam im Schlafsack) auf der einen Seite und der mit der Zeit entstandenen emotionalen Distanz und der Weite der Landschaft auf der anderen Seite, der den Film interessant macht. Es ist auch diese Weite, die den beiden immer wieder als Zuflucht dient, um dem klärenden Gespräch und der damit entstehenden Enge zu entgehen. Der Film arbeitet geschickt mit einer Art Paradox des Raumes: der weite Raum der Natur, der aus physikalischer Sicht de facto groß ist, ist für die Charaktere des Films eigentlich von bedrückender Enge. Vielleicht nicht ohne Grund spielen die Szenen ausschließlich in der freien Natur und nur in einer einzigen Szene (als sie nachts zusammen im Schlafsack liegen) im beschützenden Zelt. Schlussendlich bleibt den Figuren jedoch nur die Erkenntnis, dass trotz der ganzen Weite, die ihnen zur Verfügung steht, sie vor der Enge und dem Gespräch eigentlich nicht davonlaufen können.
Die weite Landschaft und das Wetter scheinen sich darüber hinaus wie ein Spiegelbild der Gefühlslage der beiden Hauptfiguren zu verhalten. Sinngemäß sind daher die Täler, Rastplätze und aufkommendes schlechtes Wetter immer Ort und Zeit, an dem die Konflikte zwischen den beiden aufkeimen.
Wie Giæver im Gespräch selbst erklärt, wurde der Film in 12 Tagen chronologisch gedreht. Nicht nur eine technische Notwendigkeit, sondern für die beiden Hauptdarstellerinnen auch sicherlich eine Hilfe. Somit wird die Überwindung des Raums und der Distanz nicht nur eine Notwendigkeit für die beiden Figuren, sondern auch für die beiden Schauspielerinnen, die dadurch ihren Figuren eine große Präsenz verleihen und den Film über die ganzen 73 Minuten ohne Problem alleine tragen.
Der Film ist für den weltweit bedeutendsten queeren Filmpreis „Teddy Award“ nominiert, der bei der diesjährigen Berlinale sein 25. Jubiläum feiert.